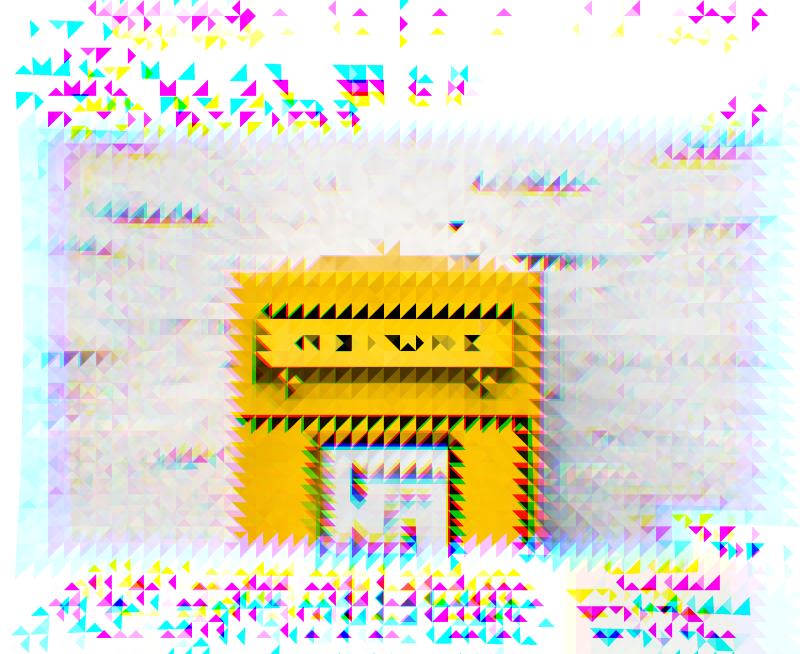Der kreuzer-Titel vom Januar und die Reaktionen auf das darin enthaltene Gespräch mit dem Roten Salon zeigen, wie sich die Szene-Linke vor Kritik schützt. Eine Erwiderung.
»Leipzig unten links« lautete der Titel des Leipziger Stadtmagazins kreuzer im Januar. Mit offener Sympathie führen Artikel, Gespräche und Biopics in die linke Szene Leipzigs ein und beschreiben dabei mehr als sie analysieren. Nur das Interview mit dem Roten Salon »Gegen wen lehnt man sich eigentlich noch auf?« fällt aus diesem Rahmen, stellt es doch die ganze wohlfeile Selbstverortung der Szene infrage. Es bildete, auch was die Anordnung als letzten Beitrag des Schwerpunkts betrifft, einen Kontrapunkt.[1]
Die grundlegende These, die im Gespräch mit dem Salon entfaltet wird, ist schnell auf den Punkt gebracht: Die Stadtgesellschaft hat sich gewandelt. Die liberalen Eliten der Stadt, ein Großteil ihrer Einwohner und die entscheidenden Kräfte in Kultur und Politik sehen sich nicht nur als weltoffen, tolerant, gentrifizierungskritisch, antifaschistisch und Subkulturen gegenüber aufgeschlossen – sie sind es auch. Die linke Szene der Stadt steht heute mit vielem, was ihr wichtig ist, noch weniger als früher in einem ideologischen Gegensatz zu den »herrschenden Verhältnissen«. Sie wird nicht an die Wand gedrängt und ist auch nicht von Auflösung bedroht, stattdessen erfährt sie öffentliche Unterstützung (wovon nicht zuletzt der kreuzer-Titel selbst zeugt) und regen Zulauf. Auch materiell gehört man in der Szene nicht zu denen ganz »unten«, wie der kreuzer-Titel neben anderen Deutungen ebenfalls suggerieren könnte, da man mit dem oberen Drittel der Gesellschaft die akademische Herkunft und das kulturelle Kapital teilt. Irgendwie wohnt man trotz Gentrifizierung noch in den jeweils angesagten Vierteln und genießt dank eines erfolgreichen Hochschulabschlusses zumeist einen höheren sozioökonomischen Status. Allerdings machen sich die wenigsten Szenelinken einen Reim auf ihren arrivierten Status, sondern einfach weiter.
Lob der Vielfalt
Auf die objektiv immer schwerer zu entkommende Ununterscheidbarkeit zwischen diskursivem Mainstream und Szene-Identität versuchen Linksradikale auf verschiedenen Wegen zu reagieren. Wer wollte, konnte einen dieser Auswege im kreuzer nachvollziehen. Den Auftakt des Schwerpunkts bildete ein Interview mit zwei Vertretern des Conne Island, die zum 30-jährigen Jubiläum des soziokulturellen Stadtteilzentrums einen Sammelband herausgegeben haben (»Auf dem Klo habe ich noch nie einen Schwan gesehen«). Das Buch, so der Interviewer Clemens Böckmann, biete einen tiefen Einblick hinter die Kulissen des linken Politik- und Kulturprojektes, weshalb die zwei Herausgeber im Gespräch erklären sollten, »warum der ehemalige Eiskeller noch immer ein Ort für Streit und Widerspruch ist«. Derart angefüttert hatte man zwei Seiten später indes nicht viel mehr erfahren, als dass die Leute aus »individuell« verschiedenen Gründen über Subkultur, Musik, und Politik ans Conne Island gekommen sind und einen antifaschistischen Grundkonsens teilen. Deshalb widme sich das Buch den Biografien der Aktivisten und gebe insbesondere ihren persönlichen Motiven Raum.
Der Erkenntnisgehalt dieser subjektivistischen Methode mag dort liegen, wo persönlich Erlebtes, Gefühltes und Gedachtes historische Entwicklungen kenntlich macht, auf sie zumindest verweist. Es braucht also eine Art Systematisierung, vorgenommen von Herausgebern, Autoren, Lesern. Die Herausgeber des Conne-Island-Buches entziehen sich allerdings dieser Aufgabe. Eine solche »theoretische Ebene« sei bereits in den letzten Jahren zur Genüge abgehandelt worden, sagen sie. Das ist natürlich nur eine etwas hilflose Umschreibung dafür, dass man es im Conne Island mittlerweile selbst aufgegeben hat, ein erkennbares politisches Profil auszubilden. Als linker Gemischtwarenladen bietet das Projekt von Tierrechtskongressen und Critical-Whiteness-Seminaren über Antifa, Feminismus bis hin zu Israelsoli und linker Selbstkritik à la Roter Salon einem breiten Themen- und Haltungsspektrum ein Zuhause. Das Programm politischer Veranstaltungen spiegelt, was an den Laden von außen herangetragen wird. Widersprüche werden ausgehalten, um es nett zu sagen. Weil man aber selbst den Anspruch aufgegeben hat, sowohl in der Stadt als auch in ihren linken Szenen ein Störfaktor oder auch nur kritisches Korrektiv zu sein, bleibt einzig die Funktion eines Dienstleisters und eben retrospektive Selbstbespiegelung.
Dabei muss man den Herausgebern dankbar sein, dass sie in ihrem Band nicht in verbalradikaler Manier gesellschaftskritische Ansprüche hochgehalten haben, die mit der tatsächlichen Außenwirkung eines linken Zentrums, von dem es heißt, es trage »deutschlandweit zum positiven Image der Stadt« (MDR) bei, im Widerspruch stehen. Allerdings kommen sie im kreuzer-Interview dann doch nicht ohne verräterischen linken Kitsch aus, der auf sprachlicher Ebene die reflektionslose Verstrickung mit dem Zeitgeist manifestiert. Das Buch solle »das breite Spektrum verschiedener Leute, die hier zusammenkommen« präsentieren, denn in »ihrer Verschiedenheit und ihrer Widersprüchlichkeit bilden sie das große Ganze«, und genau diese Vielfalt würde das Conne Island auszeichnen. »Jeder einzigartig. Zusammen vielfältig. Gemeinsam erfolgreich« ‒ dieses Motto gehört allerdings der Porsche-AG, irgendwie ja ebenfalls Leipziger, und offensichtlich teilt das Conne Island mit dem Hersteller von Luxus-PKWs die Betriebsphilosophie. Dabei handelt es sich nicht um einen semantischen Zufall, vielmehr signalisiert die Übereinstimmung den weitreichenden Geltungsbereich einer linksliberalen Wertekonstellation. Die Herausstellung von Vielfalt und Besonderheit kennzeichnet eben auch das marktökonomische Spiel von Angebot und Nachfrage. Es erlaubt die Dynamisierung von Produktionsressourcen und die zielgenaue Ansprache spezieller Konsumentenmilieus. Mit anderen Worten: Die Modernisierung der Gesellschaftspolitik und der kapitalistischen Ökonomie gehen Hand in Hand. Weil es diesen Zusammenhang gibt, nehmen auch Szene-Linke in Leipzig nicht die unteren Stufen der Gesellschaftspyramide ein. Vielmehr können sie sich als Mitproduzenten heute vorherrschender Leitwerte und als Besitzer von kulturellem Kapital viel geschmeidiger in der neuen Welt woker Ansprüche und Verhaltensregeln bewegen. Auf diese Weise ergattern sie früher oder später mehrheitlich die besseren Jobs. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Weil es aber eigentlich zum linken Selbstbild gehört, dass einem Staat und Kapital Tod und Teufel an den Hals wünschen (und umgekehrt), fällt es schwer, die geänderten Kräfteverhältnisse anzuerkennen und daraus politische Schlüsse zu ziehen. Die zwischen zwei Buchdeckel gebundene Form des Conne-Island-Buches steht dabei für eine vergleichsweise milde Verdrängungsstrategie. Ihr linksliberales »Hoch auf die Vielfalt« beinhaltet auch die Offenheit für Andersdenkende und explizit wünschen sich die Herausgeber Widerspruch, ja Streit. Geht es um linke Reaktionen auf unsere Infragestellung mythisch überhöhter Szeneheimeligkeiten legen Andere dagegen auch härtere Bandagen an.
Unsägliche Aussagen
In der Tat verspürten wir in den vergangenen Jahren mehrfach den Wunsch, unsere verschiedenen politischen Interventionen zu Connewitz mögen so etwas wie eine qualifizierte Reaktion der Szene hervorrufen, die den Beginn einer Diskussion markiert und über die üblichen knappen Unmuts- oder Sympathiebekundungen in den sozialen Medien hinausgeht. Dieser Wunsch hat sich erfüllt, wenn auch in einer Weise, die einmal mehr nichts Gutes für die Diskussionskultur und Kritikfähigkeit der Leipziger linken Szene erahnen lässt. So war es erst jene Wortmeldung im kreuzer, die offenbar drei Initiativen bzw. zwei Einzelpersonen dazu bewog, in der Februar-Ausgabe in konzertierter Aktion auf das mit uns geführte Interview zu reagieren,[2] und nicht etwa eine umfangreiche Broschüre zum »Mythos Connewitz«,[3] eine Diskussionsveranstaltung oder ein ausführliches Interview im Conne Island Newsflyer CEE IEH.[4] Eine politische Initiative gibt gar offen zu, dass der Kreuzer nie mit uns hätte reden dürfen bzw. dass wir im Interview nicht genug mit unseren Unzulänglichkeiten konfrontiert worden seien. Ein ausgesprochen instrumentelles Verständnis von Meinungsvielfalt und Pluralität, möchte man meinen. Warum aber, fragt man sich verwundert, löst ein vergleichsweise harmloses Interview, dessen zentrale Aussagen zudem in Form von Fragen daherkamen (»Gegen wen lehnt man sich eigentlich noch auf?«, »Was formuliert man an linker Gesellschaftskritik?«, usw.) überhaupt derartige Aufregung aus, dass Teile der Szene sich bemüßigt sehen, derart wutentbrannt auf die »unsäglichen Aussagen des sog ›Roten Salon‹« (Jule Nagel)[5] zu reagieren?
Die zentralen Kritikpunkte lassen eine vergleichbare Aufgeregtheit erkennen. Auf zwei von ihnen soll im Folgenden reagiert werden, weil sie 1) auf falschen Annahmen beruhen und 2) symptomatisch für eine auf einen angeblichen Rechtsruck reagierende moralische Haltung stehen.
Wohnungspolitische Krämpfe
Die erste Kritik formulierte, vorgetragen vor allem von der Vernetzung Süd und dem Hausprojekt Thierbacher Straße 6, dass wir »wohnungspolitische Kämpfe in Connewitz« klein reden bzw. die Stadtteilvernetzungsarbeit verschiedener Initiativen »delegitimieren« würden. Was war geschehen? Wir hatten in dem Interview zu bedenken gegeben, ob verschiedene Connewitzer Gruppen in ihrer Ablehnung alles Staatlichen nicht dazu neigten, lieber unter sich zu bleiben, als den größtmöglichen Resonanzraum für ihre (Gentrifizierungs-)Kritik zu suchen. Konkret ging es um die Einladung des Oberbürgermeisters zu einem Stadtteilgespräch vom September 2020, die von verschiedenen Gruppen empört und mit Verweis auf vermeintlich unannehmbare Rahmenbedingungen ausgeschlagen worden war. (Und ausgeschlagen wurde sie, liebe Vernetzung Süd, da muss man nicht drum herumreden: »Vor dem Hintergrund der oben genannten Rahmenbedingungen (…) sagen wir unsere Teilnahme ab«, hieß es im Offenen Brief vom 28. September 2020, den zu diesem Zeitpunkt 11 weitere Gruppen bzw. Einzelpersonen unterzeichnet hatten.)[6] Unser Erstaunen über diese Absage, das zudem von der Frage begleitet war, weshalb man nicht bereit sei, über die eigene politische Peergroup hinaus nach Bündnispartnern zu suchen, wurde uns nun kurzerhand als Entsolidarisierung mit in Connewitz tätigen Gruppen ausgelegt, überdies arbeite man schon seit Jahren mit solchen zusammen. Dazu sei bemerkt, dass wir in keinem Moment einem Hausprojekt wie der Thierbacher Straße 6 absprachen, sich gegen ihren Vermieter zur Wehr zu setzen, oder einer Initiative wie der Vernetzung Süd, sich zu organisieren – im Gegenteil, beides finden wir legitim, wenn nicht notwendig. Die Frage zielte vielmehr darauf, welche Gentrifizierungskritik denn eigentlich zielführend und erfolgversprechend wäre bzw. weshalb sich weite Teile der Szene dieser Diskussion versagen.
Dass es Gewalt und Sachbeschädigungen nicht sind, müsste sich bei ein wenig Nachdenken eigentlich von selbst verstehen – es lässt sich zwar nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber es dürfte wohl in den letzten Jahren in Connewitz kein einziger Neubau unvollendet geblieben oder gar aufgegeben worden sein, weil Baustellen oder leerstehende Häuser angegriffen, Mitarbeiterinnen von Immobilienfirmen zu Hause »besucht« wurden, weil das Viertel »dreckig« bleibt oder jede Hauswand mit Graffiti versehen ist. Das schreckt – Achtung, da sind sie wieder! – die bösen Investoren nicht ab. Ähnliche Erfolge hat man hinsichtlich der Vermittelbarkeit der eigenen Forderungen vorzuweisen. So mag es zwar stimmen, dass Initiativen wie die Vernetzung Süd oder »Leipzig – Stadt für alle« den Zusammenschluss mit Gleichgesinnten im Stadtteil suchen (was von uns im Übrigen nie in Abrede gestellt wurde), schaut man sich jedoch an, wer zu den Bündnispartnern zählt, wird recht schnell klar, dass hier niemand überzeugt werden muss, weil alle ohnehin entweder Betroffene sind oder aber einen linken Hintergrund teilen. Auch das ist nicht verwerflich, welcher »normale« Bürger aber, der womöglich Interesse an dem Thema hat, verirrt sich schon auf eine Demonstration, die »Soziale Kampfbaustelle« heißt, von der »Faschisierung der Gesellschaft« schwadroniert, und deren Teilnehmer sich gebärden, als würden sie gleich jemanden aufmischen wollen? Angesichts derartiger Inszenierungen, die eigentlich nur die eigene jugendliche Peergroup ansprechen, hilft auch das regelmäßige Anbringen von Transpis vor Neubauten wenig, auf denen »Scheiße« mit »sz« geschrieben steht und die dann im Internet als »Erfolg« abgefeiert werden.
Ob man es wahrhaben will oder nicht, Politik, zumal solche gegen Gentrifizierung, wird wenn, dann im Rathaus gemacht. Das zeigt nicht nur die Verabschiedung der Milieusatzungen für sechs Leipziger Stadtteile im Sommer 2020 oder der Ankauf der Südspitze des Connewitzer Kreuzes durch die Stadt, das weiß sogar Juliane Nagel, wenn sie etwa in einem Radio-Blau-Feature eingesteht, die Stadt habe eigentlich keine Handhabe, effektiv gegen hochpreisige Neubauten vorzugehen,[7] und zugleich auf Twitter zu verstehen gibt, sie wünsche sich, die Autonomen, die sonst bei jeder Gelegenheit ihren Gewaltfetisch auslebten, mögen sich einmal am »politische(n) Ringen um regulierende Instrumente« beteiligen.[8] Um auf stadtpolitische Entscheidungen Einfluss nehmen zu können – und das war der eigentliche Hintergrund des Arguments im Interview –, dazu müsste man Politik machen wollen. Dann jedoch sollte man womöglich auch Einladungen des OBM nicht leichtfertig ausschlagen.
Rechtsruck?
Ein ähnlicher Unwille, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, kommt in dem zweiten und gewichtigeren Kritikpunkt zum Ausdruck. Dieser konzentriert sich auf eine von uns angeblich nicht wahrgenommene »rechte Gefahr« bzw. einen »Rechtsruck«, dem nur durch konsequentes antifaschistisches Handeln zu begegnen sei. Diese Annahme wird von uns bestritten, wobei es sich nicht um die Leugnung rechter Umtriebe oder eines über sie hinausweisenden Meinungsspektrums handelt, sondern um einen realistischen Blick auf die Entwicklung des rechten Gefahrenpotenzials in den letzten 30 Jahren. Vielmehr gehen wir davon aus, dass zur Legitimation des »Mythos Connewitz« die unhinterfragte Aufrechterhaltung eines Bedrohungsszenarios gehört, das antifaschistische Militanz als angemessen und unbedingt notwendig erscheinen lässt. Connewitz fungiert dabei als Zentrum eines Widerstandes, der sich gegen eine feindliche Umwelt richten muss, weil das sonst keiner machen würde.
Für die Initiative »Rassismus tötet!« ist die Evaluation der rechten Gefahr Teufelszeug. Folgt man ihren Ausführungen, so war und ist Leipzig ein Hotspot rechten Terrors, eine These, für die sie in ihrer Leserzuschrift an den kreuzer mit allerlei empirischem Material Plausibilität herzustellen versucht. Gleich zu Beginn der vermeintlichen Beweisführung werden acht Namen von Opfern aufgezählt, die in Leipzig durch Rechte umgebracht wurden. Dem folgt die Schlussfolgerung: »Nirgendwo in Sachsen gibt es mehr Todesopfer rechter Gewalt als in Leipzig.« Eine Aussage mit hoher Suggestionskraft, lässt sie doch die Stadt als besonders gefährliches Pflaster für potenzielle Opfer rechter Gewalt erscheinen. Das steht ganz offensichtlich im Widerspruch zur Beobachtung eines seit Jahrzehnten anhaltenden Zuzugs gerade linker Jugendlicher. Sie kommen aus dem Umland, der Region und der westdeutschen Provinz, gerade weil ihnen Leipzig als Stadt gilt, in der sie sich als Linke politisch und kulturell relativ gefahrlos zu ihren Vorlieben bekennen können.
Um diesen Widerspruch aufzuklären, lohnt ein näherer Blick auf die Fälle. Dabei wird zunächst die Unmenschlichkeit der Taten ersichtlich.[9] Im Zusammenhang mit der Kontinuitätsthese von »Rassismus tötet!« ist aber auch der Zeitraum der Verbrechen auffällig. Die Taten liegen weit mehr als zehn Jahre zurück. Die Hälfte der politischen Mordverbrechen fand zwischen 1994 und 1996 statt, ein weiterer Vorfall ereignete sich Ende der 1990er Jahre, die anderen verteilen sich auf die Jahre 2003, 2008 und 2010. Dass die Taten weit zurückliegen, macht sie nicht ungeschehen, passt aber nicht zum nahegelegten Eindruck, Leipzig sei hier und heute ein herausragendes Zentrum rechten Terrors. Hingegen fügt es sich sehr wohl in die Aussage des Roten Salon ein, dass sich im Vergleich zu den 1990er Jahren das gesellschaftliche Klima in der Stadt deutlich liberalisiert hat und Nazis politisch bedeutungslos geworden sind.
Die von »Rassismus tötet!« in Anschlag gebrachten Todesfälle müssten noch in anderer Hinsicht hinterfragt werden. Denn auch für die 1990er und 2000er Jahre belegen sie nicht, dass Leipzig ein besonders herausragender Ort des rechten Terrors war. Vielmehr ist zu vermuten, dass gerade die Dokumentation durch antifaschistische Initiativen und das Vorhandensein einer wenigstens im Ansatz kritischen Öffentlichkeit zu einer Bekanntheit solcher Fälle führte, in denen seitens der Gerichte ein rechtes Tatmotiv nicht anerkannt wurde. Zu vermuten wäre, dass es in vielen Gemeinden Sachsens politische Morde gab, bei deren Strafverfolgung die rechten Motive unberücksichtigt blieben. Mit anderen Worten, Leipzig war, wie viele Gegenden insbesondere in Ostdeutschland, ein Zentrum rechter Gewalt. Nur unterschied es sich gerade von der Provinz, dass es hier Ansätze militanter Gegenwehr gab.
Von Connewitz nach Eisenach
»Rassismus tötet!« stellt sich ganz offensichtlich in diese Tradition des militanten Antifaschismus, ignoriert dabei aber, dass sich die Lebenswelt von Mitgliedern der Leipziger Antifa stark verändert hat. In den 1990er Jahren zielten rechte Angriffe auf linke Strukturen. Als Antifaschisten identifizierte Personen wurden gejagt, verprügelt, manche umgebracht, die Nazis wollten damit auch in Großstädten wie Leipzig die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten verändern. Brandanschläge auf linke Kneipen, besetzte Häuser, Kulturzentren ließen sich als Ausweis einer Strategie verstehen, die rechte Hegemonie herstellen, oder »national befreite Zonen« schaffen wollte. Das Anfang der 1990er Jahre in einem NPD-nahen Diskussionspapier formulierte Ziel war schon damals lautsprecherisch und illusionär, ging es doch davon aus, gegen den Willen von Staat und Kapital eine rechte Wende auf der Ebene der Zivilgesellschaft durchsetzen zu können. Doch entsprach der programmatische Gramscianismus von rechts partiell der Lebenswirklichkeit von Angehörigen alternativer Subkulturen, also einer kleinen Minderheit, insbesondere in den neuen Bundesländern. Schon die schiere Anzahl von Neonazis, ihre Präsenz in Kneipen und Diskotheken, auf Schulhöfen und in der Stadt machten das Leben von Linken, Punks und Flüchtlingen zum alltäglichen Spießrutenlauf. Dem entsprach eine recht eindeutige politische Geografie der Stadt: Reudnitz, Stötteritz, Wahren, Gohlis, Grünau, Klein- und Großzschocher waren rechte Stadtteile. Weil Nazis dort auf der Straße nur wenige politische Gegner fanden, gehörte es zu ihrem, gemeinsam mit Kameraden aus umliegenden Dörfern veranstalteten Wochenendvergnügen, im linken Stadtteil Connewitz nach ihnen zu suchen. Kaum ein Punk oder Autonomer, der bis Mitte der 1990er Jahre nicht mit Knüppel, CS-Gas oder Messer bewaffnet durch den Kiez oder die Innenstadt ging. Achtsamkeit hieß damals, gewahr zu sein, dass jeden Moment ein Auto neben einem stoppen und seine glatzköpfigen Insassen mit Baseballschläger auf einen losstürmen konnten. Schon weil die Kräfteverhältnisse waren, wie sie waren, sich Nazis an mehreren Orten der Stadt und im Umland quasi öffentlich, ungestört und in großen Gruppen treffen konnten, waren rechte Übergriffe an der Tagesordnung. Gezählt und öffentlich überhaupt wahrgenommen wurden, wenn überhaupt, nur die verhängnisvollsten, mit Todesopfern, Schwerverletzten und eineindeutigem Tatverlauf. Polizei und Strafverfolgungsbehörden ignorierten jedoch häufig Notrufe und Strafanzeigen. Zum einen, weil sich die staatlichen Behörden nach 1989 im Umbruch befanden, aber auch weil die Parameter staatlicher Sicherheitsvorsorge noch nicht auf die Existenz einer rechten Jugendbewegung abgestimmt waren. In der ideologischen Frontstellung des Kalten Kriegs verharrend, galt im wiedervereinigten Deutschland noch einige Jahre lang der Linksextremismus als die größere Herausforderung und sicher, viele Politiker und Polizisten teilten mit den Nazis die euphorische Wiederbesinnung auf nationale Zugehörigkeit.
Warum dieser historische Ausflug? Weil er Hinweise auf die veränderten Verhältnisse gibt. Connewitz ist heute nicht mehr das einzige »linke« Stadtviertel in Leipzig und in der gesamten Stadt finden sich keine augenscheinlichen Dimensionen einer dominanten rechten Jugendkultur wie sie vor 30 Jahren anzutreffen waren. Geradezu in Umkehrung der oben beschriebenen Situation muss die Antifa heute ihre Gegner suchen und in der Regel nicht vor ihnen am Straßenrand flüchten. Auseinandersetzungen gibt es nach wie vor, doch häufig sind sie von Linken gesucht. Antifa heißt Angriff, und wenn es in der Stadt an Nazis mangelt, glaubt man eben, nach Eisenach fahren zu müssen. In Leipzig jedenfalls sind Angehörige von Subkulturen heute kaum noch gezwungen, sich zu verstecken, zu bewaffnen oder vor rechtem Straßenterror zu fürchten. Selbstbewusst, nicht mehr wie auf der Pirsch oder gar verängstigt flanieren die Vertreter alternativer Subkulturen durch Connewitz und jedes andere Viertel der Stadt. Bunte Haare, Dreadlocks oder ein sich zu linken Ultras bekennender Style sind keine Einladung mehr für eine-auf-die-Fresse, sondern jugendkulturelle Normalität.
Aber mit dieser sich auf veränderte Lebenswirklichkeiten beziehenden Unterscheidung ist es so eine Sache. Aus biografischer Anschauung ist sie einfacher nachzuvollziehen, wenn man dem eigenen Erleben nicht ideologisch gegenübersteht. Die Initiative »Rassismus tötet!« verschließt sich indes gegen die Wahrnehmung von Veränderung, und muss so auch keine Erklärungen dafür finden. Mehr noch, der kritische Blick des Roten Salon auf das Auseinanderfallen von antifaschistischer Selbstlegitimation und politischer Veränderung wird von ihr als »persönliche Abrechnung mit der eigenen politischen Vergangenheit« schlecht beleumundet. Auf den Gedanken, dass dieser – in der Sache – nicht falsch beschriebene Vorgang mit Erkenntnisgewinnen auch für strategische Optionen linker Politik einhergehen könnte, kommen sie nicht. Zu groß ist die Angst vor Irritationen, die das Selbstbild betreffen.
So flüchtet man lieber in die Darstellung einer anderen Erfahrungswelt, die zwar nach wie vor von Auseinandersetzung mit Nazis geprägt ist, vernebelt aber alles, was zur historischen Unterscheidung und politischen Kontextualisierung beitragen würde. Denn selbst wer nicht, wie wir, in den 1990er Jahren politisiert wurde, findet bei Bedarf eine Unmenge von Zeitdokumenten, die einen Eindruck des Wandels vermitteln. So etwa in dem in Kooperation mit der Wochenzeitung Die Zeit produzierten Dokumentarfilm »Baseballschlägerjahre« oder in den teilnehmenden Beobachtungen eines Moritz von Uslar (»Deutschboden«, »Nochmal Deutschboden«), in den Aussagen aus den Biopics im Gesprächsband »Haare auf Krawall« oder den Beiträgen des Bandes »30 Jahre Antifa in Ostdeutschland«. Sie alle machen deutlich: In den 1990er Jahren waren die Nazis auf der Straße gefährlicher als heute.
Wilde Empirie
Die Initiative »Rassismus tötet!« versucht, diese Einsicht mit wilder Empirie abzuwehren. Neben der fragwürdigen Aufzählung von Todesopfern rechter Gewalt gehört dazu die Inanspruchnahme von Zahlen der sächsischen Opferberatung RAA. Von 2007 bis 2020 habe diese 757 rechte Angriffe in Leipzig registriert. Wir haben in der »Chronik rechtsmotivierter und rassistischer Vorfälle in Sachsen« von 2006, dem Beginn der Aufzählung, bis 2022 729 dokumentierte rechte Vorfälle gefunden.[10] Diese Korrektur ändert nichts am Gesamtbild, allerdings sollte man in noch viel grundsätzlicherer Weise Sorgfalt walten lassen, will man die Daten für die Analyse politischer Verhältnisse nutzen.
Schon aufgrund des Anfangsjahres lässt die Ereignissammlung der RAA keine Aussagen über die Entwicklung rechter Angriffe seit der Wiedervereinigung zu. Auch führt der Begriff »rechte Angriffe« auf eine falsche Fährte, denn die Dokumentation listet neben physischen Attacken und Sachbeschädigungen vor allem ein breites Spektrum von Propagandadelikten und Beleidigungen auf. So werden rechte Graffiti, Aufkleber, Pöbeleien, Postings in den Sozialen Medien und Schmierereien ebenfalls unter »Angriff« subsumiert. Ein mit Stift hingeschmiertes Hakenkreuz auf einer Tischtennisplatte oder ein Aufkleber an einem Verkehrsschild zählt genauso dazu wie eine Körperverletzung durch Nazis in der Straßenbahn.
Problematisch ist auch die durch Zuordnungsfehler verzerrte Repräsentativität der Angaben. So listet die Chronik beispielsweise für das Jahr 2008 nur zwei rechte Vorfälle in Leipzig auf. Schaut man sich die beiden Ereignisbeschreibungen an, stellt man fest, dass es sich beim ersten um das Anbringen von rechten Aufklebern in Torgau, einer 50 km von Leipzig entfernten Stadt, handelt.[11] Der andere Vorfall wiederum bezieht sich auf Rudolf Heß-Plakate in Borna und in drei anderen Gemeinden weit vor den Toren der Stadt. Es sind bei Weitem nicht die einzigen Fehlzuordnungen der Dokumentation. Noch häufiger werden Ereignisse aus weiter entfernten Orten, etwa aus Grimma und Chemnitz (2009), Görlitz (2010) und Wurzen (2019) als rechte Vorfälle in Leipzig gezählt.
An der Tendenz der Angaben ändert dies nichts. Und damit kommen wir zu dem Punkt, an dem die Argumentation des Roten Salon, es gäbe eine gesellschaftliche Liberalisierung der Stadt, scheinbar ins Wanken gerät. Die Zahlen der RAA zeigen einen Anstieg rechter Vorfälle. Die Zunahme scheint nicht ganz geradlinig, wurden zu Beginn der Aufzeichnungen 2006 15 rechte Vorkommnisse dokumentiert, waren es in den darauffolgenden Jahren 2007 und 2008 (mit oben benannter Relativierung) nur jeweils zwei. 2013 ist ein Sprung auf 33 Vorfälle verzeichnet und danach erhöhen sich die Zahlen fast kontinuierlich, bis 2021 122 rechte Ereignisse erfasst wurden.
Allerdings ist hinsichtlich der Beurteilung dieses Anstiegs Vorsicht angebracht. Zum einen muss davon ausgegangen werden, dass ein Teil davon auf eine gesteigerte Sensibilität für rechte Vorfälle zurückgeht. 2008 gründete sich in Leipzig die Rechercheplattform Chronik.LE, die seitdem Informationen über rechte Aktivitäten in der Stadt sammelt und mit zunehmender Professionalität darüber berichtet. Seit ihrer Gründung ist sie auch eine der Hauptquellen für die Chronik der RAA Sachsen. Daneben entstammen die Zahlen Presseberichten, Mitteilungen der Polizei, Auskünften auf parlamentarische Anfragen sowie Betroffenen- und Augenzeugenberichten. Gerade bei Behörden, Polizei und Medien setzte nach der Selbstaufdeckung des NSU 2011 eine Revision tradierter Wahrnehmungskategorien ein. Weil insbesondere die rassistische Motivation der Täter bei den Ermittlungen zur NSU-Mordserie jahrelang ignoriert wurde, folgte im Zuge der öffentlichen Skandalisierung eine Neubewertung von NS-Ideologieelementen. Als mögliche Tatmotive und gesellschaftliche Problemanzeige kam ihnen fürderhin ein höherer Stellenwert zu. So rollten etwa als unmittelbare Konsequenz aus der völlig fehlgeleiteten Ermittlungstätigkeit Polizeibehörden über 3000 Tötungsdelikte neu auf. Aber auch die mediale Aufmerksamkeit für Anzeichen rechter Straftaten schärfte sich, nachdem das Selbstbild der Berliner Republik durch den NSU-Skandal im In- und Ausland blamiert war. Begleiterscheinung der in den Alarmmodus versetzten Politik war die Steigerung der Ausgaben für Rechtsextremismus-Prävention und die parlamentarische Aufarbeitung in Form von Untersuchungsausschüssen. Zivilgesellschaftliche Forschungsinstitute wurden gegründet, unzählige Bücher und Artikel erschienen, Seminarprogramme und pädagogische Initiativen machten sich die gesellschaftliche Sensibilisierung für rechte Inhalte zur Aufgabe. Das alles resultierte in der zunehmenden Dokumentation rechter Vorfälle nach 2011: weil die aktivierte Aufmerksamkeit der Zivilgesellschaft Fälle wahrnahm, die davor unentdeckt blieben oder deren Problematisierung ausgeblieben war.
Allerdings handelt es sich bei der ansteigenden Tendenz rechter Vorfälle nicht einfach um ein Artefakt. Die Statistik bildet ebenso das Auftreten des Rechtspopulismus in Leipzig ab. Seit 2015 demonstrierte auch in Leipzig der örtliche Ableger der Pegida-Bewegung, die AfD gewann in Sachsen für einige Zeit immer mehr Zuspruch und in den letzten beiden Corona-Jahren waren die sogenannten Querdenker aktiv. Darin aber Kontinuität oder gar einen Rechtsruck zu erkennen, der sich in der Stadt abzeichnet, geht nur, wenn die zivilgesellschaftlichen Proteste dagegen, der schwere Stand des Rechtspopulismus in den öffentlich-rechtlichen Medien und die vereinte Ablehnung durch die etablierten demokratischen Parteien ignoriert wird. Schon die Auftaktveranstaltung von Legida zeigte das Kräfteverhältnis in der Stadt in aller symbolischer Deutlichkeit: Den etwa 3000 rechten Demonstranten standen am 12. Januar 2015 35.000 Gegendemonstranten gegenüber.
Heute kräht schon kein Hahn mehr nach den Verteidigern des Abendlandes. Zumindest ihre Organisation ist wie so viele andere rechte Vereine und Parteien in den letzten 30 Jahren in der Bedeutungslosigkeit versunken. Ein Teil ihrer Unterstützer ist bei Querdenkerdemos zu besichtigen, wählt AfD oder nationalsozialistische Kleinstparteien. Aber auch die Querdenkerbewegung und NS-Zombies wie der III. Weg sind politisch isoliert und ihr Zulauf immer nur temporär und regional begrenzt. Selbst der Aufwärtstrend der AfD ist gestoppt. Die Partei verlor bei der Bundestagswahl 2021 in Leipzig ca. fünf Prozent Stimmenanteile gegenüber der Wahl 2017.[12]
Symbolpolitik von rechts
Berücksichtigt man die tatsächlichen politischen Kräfteverhältnisse und die Begrenztheit rechter Mobilisierungserfolge, macht es vielmehr Sinn, sie als Abwehrreaktionen gegenüber einer viel wirkmächtigeren Liberalisierung zu sehen. Eine Interpretation, die sich auch mit Blick auf eine der spektakulärsten Naziaktionen in den letzten Jahren zeigt. Der Überfall auf Connewitz vom 11. Januar 2016 scheint zunächst die Kontinuität, ja die Zunahme der rechten Bedrohung zu bestätigen. Doch das Gegenteil ist richtig. Der feige Angriff von 200 Nazi-Hooligans offenbart recht eigentlich deren marginalisierte Position.
Die Angreifer kamen an einem Montag, nicht wie früher am Wochenende, als sie noch sicher gehen wollten, auf möglichst viele »Zecken« zu treffen. 2016 griffen sie zu einer Zeit an, zu der sie davon ausgehen konnten, dass der Großteil der Antifas, vor allem die Militanten, woanders, nämlich auf Gegenaktionen bei der zeitgleich im Stadtzentrum stattfindenden Legida-Demo waren. Mobilisiert hatten die Rechten von Wurzen und Dresden bis nach Niedersachsen, im Ruhrpott, Berlin und Österreich, während früher die Kameraden aus Reudnitz, Grünau und Liebertwolkwitz für einen vergleichbaren Mob ausreichten. Nichtsdestotrotz verletzten die Schläger einige Passanten, hinzu kamen beachtliche Schäden an Ladengeschäften, Wohnhäusern und Kraftfahrzeugen. Scheiß Nazis eben. Doch zelebrierten sie mit ihrer Aktion eher den eigenen Niedergang und feierten nicht den Beginn neuer Stärke. Nach 15 Minuten war der Spuk vorbei, nahezu alle Täter von der schnell eintreffenden Polizei eingekesselt, mittlerweile sind viele von ihnen rechtskräftig verurteilt – beides in den 1990er Jahren undenkbar.
Auch in den Verhandlungen der Täter vor Gericht zeigte sich, dass ihr Angriff ein Rückzugsgefecht war. Sie hatten den Zecken beweisen wollen, dass ihre Hochburg angreifbar ist, wie sich ein Beschuldigter später äußerte. Nicht die Zerstörung linker Strukturen war das Ziel, sondern postmoderne Symbolpolitik von rechts. Wie auch anders? Selbst die dümmste rechte Kampfmaschine ahnt, dass die Hoheit der Straße in den Metropolen an Antifas und Migrantengangs verlorengegangen ist. Also bleibt noch rechter Hooliganismus, mal schnell rein in den gegnerischen Block, eine Duftmarke setzten und sich später im Gym oder im Internet für die eigene Chuzpe feiern. Dabei hätten die rechten Hools der Antifa keinen größeren Gefallen tun können. Bis heute verwurstet diese die rechte Aktion, die objektiv die Defensive der Nazibewegung als auch den halbwegs funktionierenden Staatsantifaschismus unter Beweis stellte, zu einem Bestandteil der eigenen Existenzberechtigung.
Welcher Rechtsruck?
Ob solche quellenkritische und kontextualiserende Revision instrumentell verwendeter Empirie auch nur einen aufgeregten Antifa zum Innehalten bewegt? Natürlich nicht. Wer nicht schon vorher eine Spur von Zweifel am immerwährenden Rechtsruck hatte, ist wohl kaum bis zu dieser Stelle gelangt. Dabei kommt jetzt das Beste. Dass der Rote Salon im Conne Island aufgrund seiner kritischen Interventionen in der Szene nicht mehr als glaubwürdig gilt, ist uns bekannt. Aber was tun, wenn man sich ganz altmodisch der Wahrheit verpflichtet fühlt? Man sucht sich in der schwindenden Hoffnung, dass einem vielleicht doch noch geglaubt wird, Autoritätsbeweise in der Sozialwissenschaft.
Im letzten Jahr erschien ein Aufsatz von Floris Biskamp mit dem Titel »Rechtsruck, welcher Rechtsruck?«.[13] Der Autor, ein linker Akademiker, der über sogenannten antimuslimischen Rassismus und postkoloniale Theorie promoviert hat, insofern für linke Rezeptionsbedürfnisse ganz unverdächtig wirkt und eben so wenig als bekennender Renegat aufgefallen ist, kommt nach einem transparent dargelegten Quellenstudium zu einem eindeutigen Ergebnis: Es gibt keine empirischen Belege, die es erlauben, von einem Rechtsruck in Deutschland zu sprechen. Biskamp fasst mit diesem Statement die Auswertung verschiedener Ebenen zusammen. Er bezieht sich auf Studien zur Entwicklung rechtsextremer Einstellungen und Gewalt, resümiert aber ebenso den Wandel des öffentlichen Diskurses und die Veränderungen staatlicher Politik. Auf keiner dieser Ebenen sieht er Anhaltspunkte für einen Rechtsruck. Zwar gebe es ein gefährliches rechtes Potenzial, das insbesondere für Gegner und Opfergruppen ein Problem darstellt. Die gesellschaftliche Mehrheit aber bewegt sich in die andere Richtung. Wer dennoch von einem Rechtsruck spricht, verkläre damit die Verhältnisse in der alten Bundesrepublik, den Autoritarismus in der DDR und die rechte Gewalt der Baseballschlägerjahre in den 1990ern. Er gehe damit aber auch der rechten Propaganda auf dem Leim, die von sich selbst behauptet, für die Mehrheit im Volk zu sprechen.
Dem können wir nur zustimmen und über eine Veranstaltungseinladung nachdenken. Die Initiative »Rassismus tötet!« überzeugt aber auch ein Floris Biskamp nicht. Ihr militanter Antifaschismus sperrt sich gegen Urteilskraft. Nur so kann sie im Stadtmagazin behaupten, Leipzig habe sich nicht zu einer liberalen, bunten Stadt entwickelt, sei also im Umkehrschluss noch immer die ostdeutsche Provinz, in der Nazis seit 30 Jahren die Straßen dominieren.
Dabei ist selbst diese Wirklichkeitsabwehr Anzeichen gesellschaftlicher Liberalisierung, die eben nicht nur für Rechte eine Bedrohung ist. Denn auch militanter Antifaschismus ist durch sie infrage gestellt. Der ganze Leserbrief der Initiative lässt sich auch als Ausdruck einer identitätspolitischen Verunsicherung lesen. Welche Legitimation, welches Alleinstellungsmerkmal hätte die linksradikale Antifa noch, würde sie sich eingestehen, dass der Mainstream der Stadtgesellschaft links und antirassistisch ist, und die richtige Aussage, dass Rassismus tötet bis in die Chefetagen der Politik heutzutage betroffene Zustimmung auslöst? Der Gruppenzusammenhalt und die Praxis wären zutiefst gefährdet, man selbst stünde gewissermaßen im Staatsdienst und müsste die eigene Wirksamkeit im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Instanzen, beispielsweise Schule, Kirche, Medien und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen messen. Um es so weit auf gar keinen Fall kommen zu lassen, beschwört die Initiative lieber mit einigem Pathos ihre Daseinsberechtigung: »Wir haben den Betroffenen rechter Gewalt zugehört, wir standen am Grab von Kamal K. und erinnern jährlich an die Betroffenen rechten Terrors in diesem Land und in dieser Stadt. Wir waren in den vergangenen Jahren gegen den rechten Mob auf der Straße […]. Wir waren und sind selbst oft genug von rechter Gewalt und staatlicher Repression betroffen.« Wer soviel Eigenlob nötig hat, muss eine tiefe Verunsicherung spüren und wird diese auch in Zukunft durch die Verteufelung jeglicher Kritik zu übertünchen versuchen.
Leipzig, April 2022
1 https://kreuzer-leipzig.de/2022/01/14/gegen-wen-lehnt-man-sich-eigentlich-noch-auf.
2 https://kreuzer-leipzig.de/2022/01/27/wo-wart-ihr-in-den-letzten-15-jahren#comments.
3 https://roter-salon.conne-island.de/the-great-connewitz-swindle.
4 https://www.conne-island.de/nf/268/8.html.
5 https://twitter.com/luna_le.
6 https://vernetzungsued.de/Offener-Brief-Stadtteilgespraech.
7 https://awc-eg.de/wie-kam-die-subversion-nach-connewitz.
8 https://twitter.com/luna_le.
9 https://chronikle.org/dossiers/todesopfer-rechter-gewalt-um-leipzig.
10 https://www.raa-sachsen.de/support/chronik.
11 https://www.raa-sachsen.de/support/chronik?landkreis=Stadt+Leipzig&jahr=2008.
12 https://static.leipzig.de/Wahlbericht_Bundestagswahl_2021.
13 Floris Biskamp, Rechtsruck, welcher Rechtsruck?.